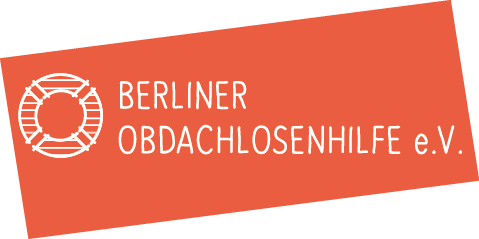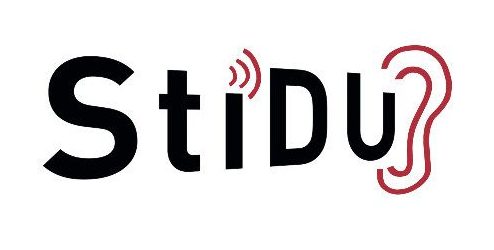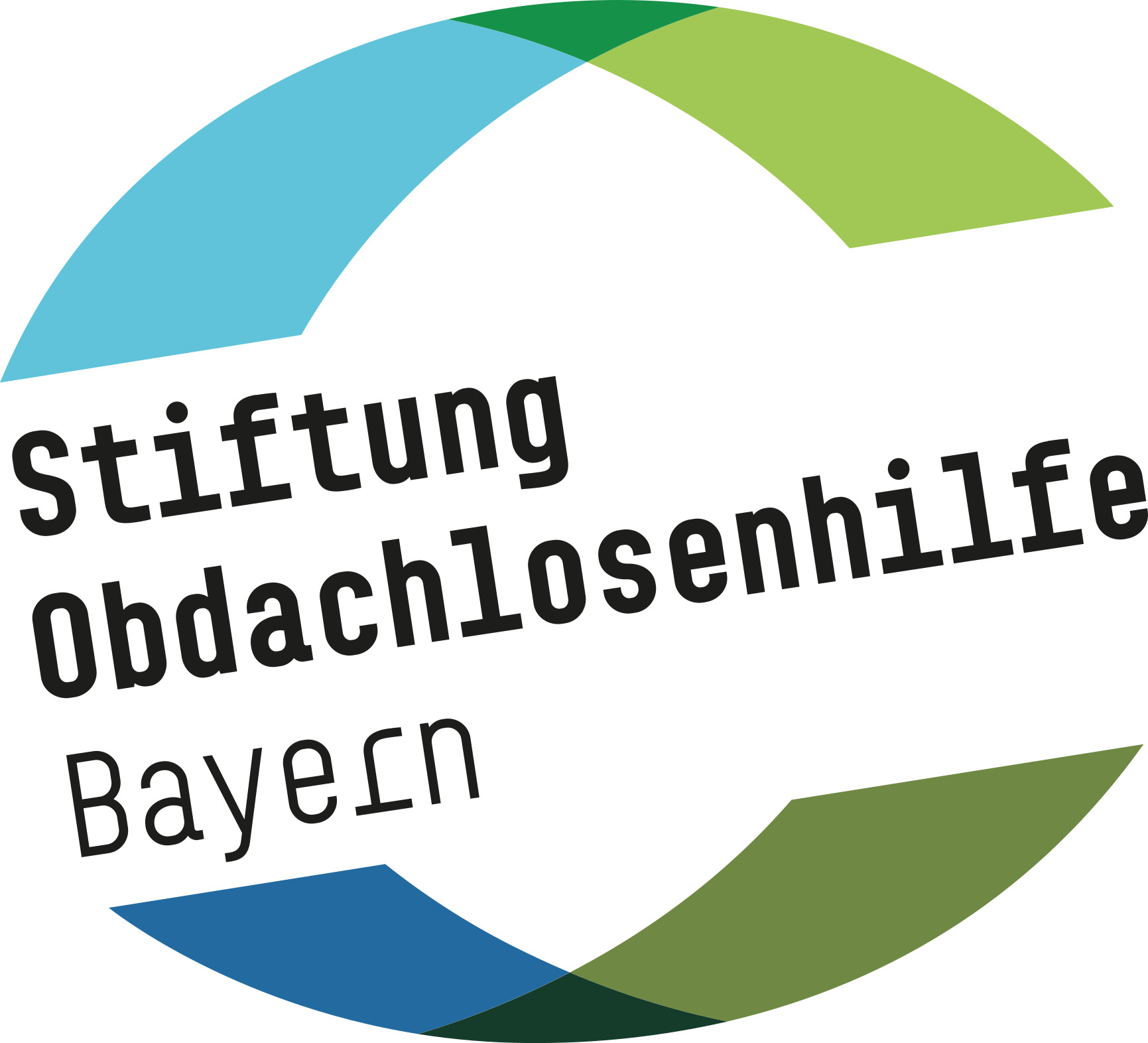Guten Tag,
in unserem heutigen Newsletter veröffentlichen wir einen Gastbeitrag von André Hoek und sagen gleichzeitig herzlichen Dank, André.
Kommt gut durch den Sommer! Solidarische Grüße, Stefan
****************
André Hoek - Niemand ist ärmer als Obdachlose
Kein Besitz. Kein Zuhause. Kein Halt.
Ich war 15 Monate obdachlos. Wenn ich heute sage: Niemand in Deutschland ist ärmer als ein Obdachloser, dann meine ich das genau so.
Denn Obdachlosigkeit ist nicht einfach eine Form von Armut – sie ist der Absturz ins Nichts.
Man hat keine Wohnung, keine Tür, die man hinter sich zumachen kann. Man hat keinen Schlüssel, keinen Briefkasten, keine Klingel. Keine Adresse, kein Konto, kein Einkommen. Man ist aus allem herausgefallen, was normalerweise ein menschliches Leben in dieser Gesellschaft strukturiert: keine Termine, keine Verpflichtungen, aber auch keine Rechte, keine Sicherheit, keine Hilfe.
Was bleibt, ist ein Körper, der funktioniert – oder eben nicht. Ein Rucksack mit dem Allernötigsten. Eine Plastiktüte. Vielleicht ein Schlafsack, wenn man Glück hat. Und das Leben draußen – bei jedem Wetter, in jeder Jahreszeit, inmitten einer Gesellschaft, die dich sieht, aber nicht wahrnimmt.
Die Leute stellen sich Armut oft falsch vor. Sie denken an wenig Geld, an Verzicht, an gebrauchte Kleidung. Aber wer obdachlos ist, lebt nicht in „Verzicht“, sondern in völliger Mittellosigkeit.
Man besitzt nur, was man tragen kann. Und wenn einem das geklaut wird – was häufig passiert –, dann besitzt man gar nichts mehr. Keine Papiere. Keine Decke. Kein Ausweis. Und niemand kümmert sich darum.
Obdachlosigkeit heißt: Du fällst – und es gibt keinen Boden, der dich auffängt.
Der Tag beginnt mit dem ersten Problem
Ich wache auf, bevor die Sonne richtig aufgeht. Nicht, weil ich ausgeschlafen bin, sondern weil es zu laut ist, zu kalt, zu unruhig. Ich liege draußen, irgendwo – unter einer Brücke, in einem Park, manchmal am Rand eines Bahnhofs. Es ist nie wirklich bequem. Meistens ist es hart. Und immer ist es öffentlich.
Das erste, was ich merke, ist der Schmerz. Das Bein. Es zieht, es brennt, es pocht. Ich weiß genau, das wird heute wieder schlimm. Eigentlich müsste ich längst zum Arzt. Aber ich bin nicht versichert. Und selbst wenn: Wo sollte ich heute die Zeit hernehmen für eine Ambulanz? Ich muss raus. Ich muss los. Ich muss Geld machen.
Ich setze mich langsam auf. Der Körper fühlt sich alt an. Müde, ausgezehrt, träge. Und das mit Mitte vierzig. Man ist immer müde. Nicht von gestern – sondern von allem. Vom Leben im Sitzen, Warten, Laufen, Kämpfen. Vom ewigen Mangel. Vom Stress, nirgends richtig sein zu dürfen. Vom Frieren. Vom Schlafen ohne Schlaf.
Und dann kommt das Zittern. Die Unruhe. Die Übelkeit. Ich brauche Alkohol. Nicht aus Lust – sondern weil mein Körper ihn verlangt. Weil ich sonst in den Entzug rutsche. Ich kenne die Symptome: Herzrasen, Angst, Schweiß, Krämpfe. Ich habe Leute daran sterben sehen. Wirklich sterben.
Aber ich habe keinen Cent. Also muss ich los. Muss Flaschen sammeln. Muss hoffen, dass ich schneller bin als die anderen. Dass mir niemand heute zuvor kommt. Dass ich genug zusammenkriege, um wenigstens die schlimmsten Symptome zu deckeln – und vielleicht etwas zu essen.
Ich laufe los, obwohl jeder Schritt schmerzt. Ich laufe, obwohl ich kaum geschlafen habe. Ich laufe, weil ich keine Wahl habe.
Jeden Morgen beginnt der Tag mit einem Problem, für das es keine richtige Lösung gibt. Und danach kommt das nächste.
Laufen, sammeln, betteln – ein endloser Kreislauf
Ich ziehe durch die Straßen. Ich kenne die guten Ecken. Parks, Bahnhöfe, Mülleimer, wo oft Pfandflaschen drin liegen. Aber ich bin nicht der Einzige, der das weiß. Andere waren schon da. Manchmal sind die Tonnen leer, bevor ich überhaupt losgegangen bin. Dann geht’s weiter zum nächsten Viertel.
Das Bein schmerzt, aber ich muss weiter. Ich darf mich nicht zu lange ausruhen – zu viele andere sammeln auch. Wer schneller ist, hat den Euro. Wer langsamer ist, geht leer aus. Und ein leerer Tag bedeutet: kein Alkohol, kein Essen, kein Nichts.
Ich finde drei Dosen 25 Cent pro Stück. 75 Cent. Dafür kriege ich zwei Brötchen oder eine Dose Bier – aber eben nicht beides. Ich rechne schon beim Sammeln: Was reicht heute? Was ist unbedingt nötig? Was kann ich streichen?
Ich denke auch ans Betteln, aber das ist noch schwieriger. Du sitzt stundenlang in der Fußgängerzone, streckst die Hand aus, stellst den Becher hin. Und es passiert: nichts. Manche sehen dich nicht einmal. Andere gucken absichtlich weg. Einer sagt: „Such dir halt ’nen Job.“ Einer gibt 10 Cent. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich immer. Man darf sich nichts anmerken lassen, sonst kommt gar nichts mehr.
Zwischendurch muss ich mich setzen. Nicht aus Bequemlichkeit – aus Not. Mein Bein macht dicht. Ich setze mich auf einen Stein, warte 30 Minuten, dann weiter. Immer weiter.
Der ganze Tag ist ein einziger Versuch, den Absturz ein kleines Stück hinauszuzögern.
Und wenn man abends das Geld in der Hand zählt, merkt man: Es hat wieder nicht gereicht. Nicht mal für das Nötigste.
Schmerzen, Krankheit, keine Hilfe
Seit Tagen schleppe ich dieses Bein mit mir herum. Es ist dick, entzündet, heiß. Jeder Schritt ist ein Stich. Ich weiß genau: Das ist nicht harmlos. Das müsste behandelt werden. Eigentlich müsste ich liegen, schonen, kühlen. Aber wie denn?
Ich kann nicht einfach zum Arzt gehen. Ich bin nicht versichert. Keine Krankenkasse, keine Chipkarte, kein Termin. Und in der Obdachlosenambulanz können sie mir oft auch nur Schmerzmittel geben. Wenn überhaupt. Kein Röntgen, kein Blutbild, kein MRT. Nur Pflaster und Ibuprofen.
Also laufe ich weiter. Auch heute. Auch morgen. Weil ich muss. Weil ich keine andere Wahl habe. Ich brauche das Geld. Ich brauche die Flaschen. Ich brauche irgendwas, das diesen Tag überbrückbar macht.
Und die Gedanken sind schon weiter: Was ist, wenn es schlimmer wird? Wenn ich in zwei Wochen gar nicht mehr laufen kann? Dann war’s das. Ich saß mal neun Monate im Rollstuhl, auf der Straße. Da fängt das Elend erst richtig an. Ohne Beine kein Flaschensammeln. Ohne Bewegung kein Überleben.
Krankheit ist auf der Straße nicht einfach unangenehm – sie ist gefährlich.
Weil niemand kommt, wenn du fällst. Weil niemand anruft. Weil keiner nachfragt. Weil du auf keiner Liste stehst.
Und irgendwann begreifst du: Wenn du jetzt zusammenbrichst, dann merkt das vielleicht tagelang keiner. Und wenn doch, dann bist du der „Obdachlose mit dem Bein“, für ein paar Minuten Aufmerksamkeit – und danach wieder vergessen.
Kein Rückzugsort, keine Tür, kein Feierabend
Irgendwann ist der Tag „geschafft“. Ich habe gesammelt, ich habe gebettelt, ich habe gerechnet. Ich habe vielleicht sechs, sieben Euro in der Tasche – wenn es gut lief. Ich kaufe das Nötigste: ein Brot, ein Getränk, vielleicht eine kleine Flasche Bier gegen das Zittern. Mehr geht nicht. Viel weniger darf es auch nicht sein.
Und dann stellt sich die Frage: Wohin jetzt?
Alle anderen kehren jetzt heim. Machen die Tür hinter sich zu. Ziehen die Schuhe aus. Kochen sich was. Setzen sich auf ihr Sofa. Ich kenne das – ich hatte früher auch mal eine Wohnung. Aber heute gibt es für mich keinen Ort, an den ich zurückkehren könnte. Kein Zimmer. Kein Bett. Kein Schlüssel in der Tasche.
Ich setze mich irgendwo hin – eine Bank im Park, eine dunkle Ecke hinter dem Bahnhof, eine Nische in einer Tiefgarage. Ich überlege: Wo ist es heute halbwegs ruhig? Wo könnte ich heute Nacht vielleicht mal drei, vier Stunden schlafen, ohne dass mich jemand tritt, wegschickt oder beklaut?
Denn nachts wird es gefährlich. Es gibt viele, die es auf Obdachlose abgesehen haben. Nicht immer nur andere Obdachlose – auch Jugendliche, Besoffene, Polizisten, die dich „verlagern“ wollen. Du bist nie sicher. Du schläfst nie wirklich. Du döst, wachsam, halb angezogen, mit einem Arm um den Rucksack.
Und irgendwann dämmert es. Ein neuer Tag steht bevor. Und du weißt jetzt schon: Er wird genauso.
Es gibt keinen Feierabend in der Obdachlosigkeit. Nur ein endloser Strom von Tagen, durch den du dich schleppst.
Die große Leere – Tristesse, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit
Die schlimmste Armut auf der Straße ist nicht materiell – sie ist innerlich.
Natürlich: Der Hunger ist real. Die Schmerzen sind real. Die Kälte, die Angst, die Müdigkeit – alles real. Aber am schlimmsten ist das, was sich im Inneren abspielt. Diese Leere. Diese endlose Gleichförmigkeit. Dieses Wissen: Es ändert sich nichts.
Die Tage gleichen sich wie Wassertropfen. Jeder ist wie der davor – und wie der danach. Du wachst irgendwo auf, schleppst dich los, suchst nach Flaschen, bettelst, wirst ignoriert, zählst deine Centstücke, überlegst, wo du heute schläfst – und am Ende sitzt du wieder irgendwo, schaust auf den Boden und weißt: Morgen wird es genauso sein.
Und das ist der Unterschied zu fast allen anderen Lebenskrisen.
Wer arbeitslos ist, hat vielleicht einen Antrag laufen. Wer krank ist, bekommt irgendwann einen OP-Termin. Wer in Schulden steckt, kann hoffen auf einen Vergleich, eine Ratenzahlung, ein Ende.
Aber als Obdachloser weißt du: Das bleibt so.
Nächste Woche, nächster Monat, vielleicht noch nächstes Jahr – wenn du dann noch lebst.
Du bist nicht nur arm – du bist abgehängt. Du hast keine Funktion mehr in dieser Gesellschaft. Kein Zuhause, keine Aufgabe, keine Perspektive. Viele sprechen dich gar nicht mehr an, sondern nur noch über dich. Und wenn dich jemand doch mal fragt, wie’s dir geht, weißt du oft selbst keine Antwort. Es ist zu groß, zu schwer, zu leer.
Die Einsamkeit wird dabei irgendwann nicht mehr schmerzhaft – sie wird einfach normal.
Du redest kaum noch. Du lachst nicht. Du planst nichts. Du existierst nur.
Und du fragst dich manchmal, ganz still: Warum überhaupt noch?
Was du tun kannst
Wenn du bis hierher gelesen hast, fragst du dich vielleicht: Was kann ich tun?
Die Antwort ist einfach. Und unbequem: Gib Geld.
Ja – auch wenn du denkst, das wird für Alkohol ausgegeben. Wahrscheinlich wird es das. Weil viele auf der Straße suchtkrank sind. Weil Entzug kein „Verzicht“ ist, sondern eine körperliche Krise, die lebensgefährlich sein kann. Wer morgens zittert, schwitzt, erbricht – der braucht Hilfe. Und zwar sofort. Nicht morgen. Nicht, wenn er „sauber“ ist. Sondern jetzt.
Und wenn du etwas gibst – dann gib so, als wärst du der Einzige.
Denn oft ist es genau so. Zwei-, dreihundert Menschen laufen an einem Obdachlosen vorbei, bevor einer stehenbleibt. Und wenn dann 20 Cent in den Becher fallen, bedanken wir uns dafür, als wäre es ein Geschenk. Dabei reicht das nicht einmal für einen halben Apfel beim Discounter.
Fünf Euro sind viel Geld für jemanden, der jeden Cent zählen muss – aber für viele, die auf dem Weg zur Arbeit, zum Bäcker oder ins Fitnessstudio gehen, sind sie verzichtbar. Zehn Euro verändern vielleicht deinen Tag nicht – aber vielleicht retten sie meinen.
Nicht symbolisch. Ganz konkret.
Du musst das nicht jeden Tag tun. Nicht für jeden, nicht überall.
Aber wenn du gibst – dann gib nicht das, was du übrig hast. Gib das, was wirklich hilft.
++++++++++++++++++++++++++
Text: André Hoek (https://www.andre-hoek.de/)
Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Andre_Hoek_neu.jpg