2025_08_29 - Obdachlos sein: Die Todgeweihten grüßen Euch - Gastbeitrag von André Hoek
Guten Tag,
heute in unserem Newsletter wieder ein Gastbeitrag von André Hoek und wir sagen herzlichen Dank, André.
Kommt gut durch den Spätsommer! Solidarische Grüße, Stefan
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
André Hoek - Die Todgeweihten grüßen Euch
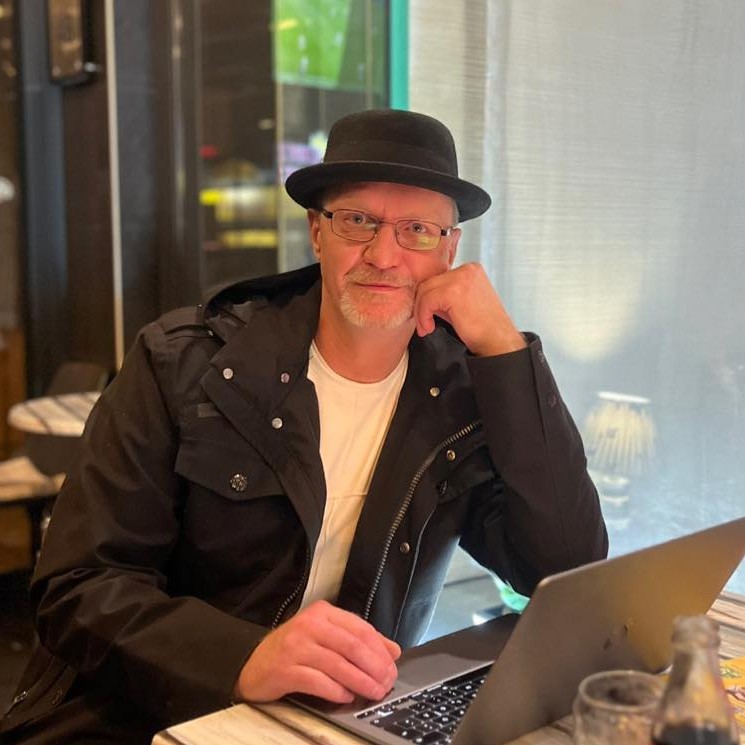 Es gibt Menschen, denen man sich verbunden fühlt, auch wenn man mit ihnen sonst nichts gemeinsam hat. Keine Herkunft, keine Bildung, keine Sprache, kein Lebensstil. Aber da ist etwas, das zwischen einem steht – wie eine unsichtbare Brücke aus gemeinsam überlebter Zeit.
Es gibt Menschen, denen man sich verbunden fühlt, auch wenn man mit ihnen sonst nichts gemeinsam hat. Keine Herkunft, keine Bildung, keine Sprache, kein Lebensstil. Aber da ist etwas, das zwischen einem steht – wie eine unsichtbare Brücke aus gemeinsam überlebter Zeit.
Wenn ich heute jemanden treffe, mit dem ich damals draußen war, dann reicht oft ein kurzer Blick. Ein Nicken. Ein Satz. Wir müssen nicht viel sagen. Wir wissen. Wir waren da. Und wer dabei war, vergisst es nie. Und wer nicht dabei war, wird es nie ganz begreifen.
Damals habe ich diesen Text unter dem Arbeitstitel „Veteranen“ geplant. Nicht, weil ich mich wichtig machen wollte. Sondern weil ich keinen besseren Begriff dafür hatte, was uns verbindet:
Wir haben eine Wirklichkeit erlebt, die der normale Mensch nicht kennt.
Nicht Armut. Nicht Randständigkeit. Sondern einen Zustand, in dem es keine Sicherheiten mehr gibt. Keine Privatsphäre. Keine Kontrolle. Kein Schutz.
Wir waren nicht einfach nur „ohne Wohnung“.
Wir waren aus allem herausgefallen.
Wie Veteranen eines Krieges, den die Gesellschaft gar nicht wahrnimmt.
Es gibt kein Dazwischen
Am Anfang, als ich auf der Straße gelandet war, habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was das eigentlich heißt: obdachlos zu sein. Ich meine nicht die Theorie. Nicht „kein Zuhause haben“, nicht „in Notunterkünften schlafen“. Sondern das, was es wirklich bedeutet: draußen zu leben.
Ziemlich am Anfang habe ich gemerkt: Alles, was vorher war – mein Leben auf Gran Canaria, das Geld, die Sicherheit, die Sonne, der Rhythmus – das kommt nicht mehr zurück. Es ist nicht pausiert. Es ist vorbei. Und wenn ich das hier überleben will, dann geht das nur, wenn ich genau das akzeptiere.
Ich habe diesen Gedanken nicht verdrängt, sondern ganz bewusst zugelassen:
„Du bist jetzt draußen. Nicht auf Zwischenstation. Nicht im Übergang. Du bist hier – und das ist dein Leben.“
Ich habe später viele Menschen getroffen, die das nicht geschafft haben. Die liefen mit einer Plastiktüte rum, in der noch ein alter Arbeitsvertrag steckte oder ein Foto aus besseren Zeiten. Die sagten: „Ich bin ja eigentlich gar nicht obdachlos.“ Und Monate später waren sie kaum wiederzuerkennen. Psychisch krank, körperlich abgebaut, innerlich verloren. Nicht, weil sie schwach waren – sondern weil sie festhielten, wo man loslassen musste, um zu überleben.
Das war mein erster innerer Wendepunkt.
Nicht, dass ich Hoffnung geschöpft hätte – im Gegenteil.
Ich habe die Hoffnung auf Rückkehr erst einmal begraben, damit ich nicht untergehe. Und genau das hat mich getragen.
Die Welt draußen
Die Welt draußen hat eigene Regeln. Und sie kennt kein Pardon. Alles, was in der bürgerlichen Welt selbstverständlich ist – Sicherheit, Rückzug, Schutz, Struktur – existiert dort nicht mehr.
Du schläfst nicht, du döst in Alarmbereitschaft. Jede Bewegung, jedes Geräusch kann bedeuten: Gefahr.
Du isst nicht, wenn du hungrig bist – du isst, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Du hast keinen Ort, du hast nur den Moment.
Und immer ist da diese Angst im Hintergrund:
Was, wenn ich heute Nacht überfallen werde? Wenn mich jemand weckt, vertreibt, schlägt? Wenn ich nicht rechtzeitig aufwache, wenn es gefährlich wird?
Es kann jederzeit alles passieren. Das ist kein Spruch – das ist der Alltag.
Ich habe bei meinen Vorträgen oft gesagt:
„Auf der Straße kann jederzeit alles passieren.“
Und ich habe es gleich noch einmal gesagt – weil viele beim ersten Mal nicht verstehen, was das wirklich bedeutet.
Man sitzt irgendwo, trinkt ein Bier, raucht eine Zigarette – und plötzlich kommen die falschen Leute um die Ecke. Dann bleibt keine Zeit. Keine Entscheidung. Dann musst du kämpfen – sofort.
Nicht, weil du willst. Sondern weil du sonst untergehst.
Draußen sein heißt: Du hast keine Deckung. Keine Türen. Keine Regeln. Nur dich selbst – und was du in der nächsten Sekunde tust. Oder nicht mehr tun kannst.
Und das Schlimme ist: Du gewöhnst dich daran.
An den Druck. An die Gewalt. An das kalte Pflaster unter deinem Körper.
Es wird Alltag. Und genau das ist das eigentlich Erschütternde.
Die Nacht mit der Flasche
Ich wurde einmal durch einen Tritt gegen den Kopf geweckt.
Ich lag unter einer Brücke, in Hannover, hatte geschlafen, oder das, was auf der Straße eben Schlaf ist – und dann kam plötzlich dieser Schmerz. Ich hatte nicht mal Zeit, mich zu orientieren. Der Angreifer trat weiter. Ich kam irgendwie auf die Beine, versuchte mich zu schützen, aber dann hatte er schon eine abgeschlagene Flasche in der Hand.
Ich hatte nichts. Keine Jacke, kein Stock, kein Schutz. Nur meine Hände.
Also habe ich sie hochgehalten. Einfach nur, um nicht im Gesicht getroffen zu werden.
Er hat mehrfach zugestochen. Ich habe keine Gegenwehr geleistet – ich habe nur abgewehrt. So gut es ging.
Am Ende waren beide Hände schwer verletzt. Die rechte so schwer, dass ich monatelang eine Gipsschiene tragen musste. Zwei Finger sind bis heute steif. Die linke Hand war über ein halbes Jahr lang im Verband. Es gab Infektionen, Fieber, fast wäre die rechte Hand amputiert worden. Ich war wochenlang im Krankenhaus. Und als ich entlassen wurde – da ging es zurück auf die Straße.
Es gab keinen anderen Ort. Keine Einrichtung, keine Hilfe. Kurze Zeit später fiel ich für drei Wochen ins Koma und als ich wieder wach wurde, konnte ich nicht mehr gehen und musste in den Rollstuhl. Aber auch da ging es nach dem Krankenhaus gleich wieder nach Draußen.
Ich saß also, unfähig zu gehen, mit zwei bandagierten Händen, draußen.
In derselben Kälte wie vorher.
In derselben Gefahr.
Aber genau das ist die Wahrheit: Es ist nicht der Ausnahmefall, der dich zerstört – es ist die völlige Abwesenheit von Schutz.
Die Tatsache, dass alles jederzeit möglich ist – und dass dir niemand glaubt, wenn du es erzählst.
Der Weg nach unten
Auf der Straße gibt es eine Grenze, die nicht viele benennen können, aber jeder spürt sie. Ich nenne sie den Point of No Return.
Das ist nicht der Moment, wo man auf der Straße landet. Es ist auch nicht der Moment, wo man aufgibt.
Es ist der Punkt, an dem ein Mensch so tief gesunken ist, dass man merkt: Der kommt hier nicht mehr raus. Der ist auf dem letzten Abschnitt seines Weges. Und der endet im Tod.
Ich habe viele gesehen, die an diesem Punkt waren. Man erkennt es, wenn man draußen lebt.
Die Haltung ändert sich. Der Blick verliert den Fokus. Die Sprache wird fahrig, manchmal nur noch Gemurmel.
Der Mensch sitzt da – aber er ist nicht mehr wirklich da.
Er lebt noch. Aber innerlich ist er schon unterwegs.
Und wenn du ihn anschaust, weißt du: Vier Wochen. Vielleicht sechs. Dann ist er weg.
Ich habe mich nie getäuscht.
Kein einziger, den ich in diesem Zustand gesehen habe, hat es überlebt.
Und als ich selbst ganz am Ende war, wusste ich:
Jetzt bin ich über diese Schwelle. Jetzt bin ich dran.
Ich hatte keine Kraft mehr. Mein Körper war ausgezehrt. Ich war kaum noch in der Lage, mich zu versorgen.
Ich wusste: Wenn sich nichts ändert, dann sterbe ich hier.
Und ich war bereit dafür.
Ich habe mich damals um einige dieser Todgeweihten besonders gekümmert.
Ihnen Essen gebracht. Alkohol. Nicht, weil ich sie „retten“ wollte – das ging nicht mehr. Sondern weil ich wollte, dass sie nicht allein gehen. Habe Ihnen das Sterben etwas angenehm gemacht, so weit es mir möglich war.
Und auch, weil ich wusste: Ich bin selbst nur einen Schritt entfernt.
Der Suizid als Reserve
Es klingt vielleicht widersprüchlich, aber in der schlimmsten Phase meines Lebens war der Gedanke an den Suizid das Einzige, was mir Kraft gegeben hat.
Nicht, weil ich sterben wollte. Sondern weil ich wusste:
Wenn ich es irgendwann nicht mehr aushalte – dann kann ich gehen.
Das war kein dramatischer Entschluss, keine akute Verzweiflung, sondern eher eine stille innere Option.
Wie ein letzter Notausgang in einem brennenden Gebäude.
Ich wusste, dass ich nicht ausgeliefert war.
Nicht ganz.
Damals gab es Tage, da war die Kälte unerträglich, der Schmerz in meinem Körper dauerpräsent, die Einsamkeit wie eine bleierne Decke. Ich konnte kaum noch denken. Konnte kaum noch glauben, dass irgendetwas noch irgendeinen Sinn hatte.
Aber dann kam dieser Gedanke – nicht als Trost, sondern als Ruhepunkt:
Du kannst jederzeit gehen. Du musst nicht für immer aushalten. Nur noch diesen einen Tag. Dann kannst du immer noch entscheiden.
Und dieser Gedanke hat mich durch viele Tage gebracht.
Ich glaube, viele Menschen draußen kennen das. Und ich glaube, viele würden noch leben, wenn man ihnen diesen Gedanken nicht genommen hätte, durch gut gemeinte Warnungen, durch Bevormundung, durch Angst.
Denn manchmal ist es gerade das Wissen, dass man gehen dürfte, was einen am Leben hält.
Ich bin geblieben.
Aber nicht, weil ich so stark war.
Sondern weil Gott mich gehalten hat – und weil ich wusste, dass ich jederzeit loslassen könnte.
Was mich nicht verrohen ließ
Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich daran nicht zerbrochen bin. Warum ich nicht verroht bin, nicht abgestumpft, nicht innerlich taub geworden – obwohl es genug Gründe dafür gab. Ich habe Gewalt erlebt, Krankheit, fast den Tod. Ich habe Menschen sterben sehen. Ich habe Dinge erlebt, die man nicht mehr loswird, egal wie viele Jahre vergehen. Und doch ist etwas in mir ganz geblieben.
Was mich gehalten hat, war mein Glaube. Nicht als Trostpflaster, nicht als Flucht, sondern als das Letzte, woran ich mich überhaupt noch festhalten konnte. Ein innerer Anker, der blieb, als außen alles weggeschnitten war.
Ich hatte fast immer eine Bibel bei mir. Manchmal war sie zerfleddert, nass, verloren, aber sie kam immer wieder zu mir zurück, so wie manch andere Dinge einfach verschwinden. Ich habe darin gelesen – auch betrunken, auch nachts, auch frierend. Ich habe gebetet, obwohl ich nicht wusste, ob noch jemand zuhört. Aber ich habe nie aufgehört, Ihn zu meinen.
Irgendwann habe ich auch aufgehört, Gott nach dem „Warum“ zu fragen. Nicht, weil es keine Fragen mehr gegeben hätte – sondern weil ich verstanden habe, dass mir diese Frage nicht zusteht, dass es nicht meine Rolle ist, Rechenschaft zu verlangen. Ich habe begriffen, dass ich vieles nicht verstehe, dass ich es auch nicht verstehen muss. Dass Gott nicht mir antwortet – sondern dass ich Ihm vertraue, gerade dort, wo ich nichts begreife.
Vertrauen ohne Verstehen – das war mein Wendepunkt.
Und dieses Vertrauen hat mir etwas zurückgegeben, das draußen kaum einer hat: Würde.
Nicht Stolz. Nicht Stärke. Sondern einfach nur das Wissen: Ich bin noch jemand. Auch wenn alles andere verloren ist.
Ich habe mit Gott gehadert. Ich habe Ihn angeschrien, Ihn beschuldigt, Ihn ignoriert. Aber ich bin nie von Ihm weggegangen. Und Er – das glaube ich bis heute – ist auch nie von mir gegangen.
Die, die man nicht mehr sieht
Wenn die Leute über Obdachlose sprechen, meinen sie meist die, die noch irgendwie „dabei“ sind. Die ansprechbar sind. Die freundlich oder laut oder zugänglich wirken.
Aber die, die am tiefsten gefallen sind, die sieht man nicht mehr.
Nicht, weil sie sich verstecken – sondern weil sie in einem Zustand sind, den niemand mehr begreifen will.
Ich meine die, die irgendwo am Rand eines Bahnhofseingangs hocken.
Verdreckt. Mit leerem Blick.
Ein zerfleddertes Exemplar der Obdachlosenzeitung in der Hand, das sie stumm hochhalten.
Die kaum noch sprechen, oder nur noch unverständliches Zeug murmeln.
Die, vor denen selbst engagierte Helfer oft zurückweichen, weil sie unheimlich wirken.
Weil sie nicht mehr erreichbar sind.
Weil sie nicht mehr hier sind.
Diese Menschen sind nicht verrückt geworden.
Sie sind zermürbt worden.
Durch Jahre. Durch Kälte. Durch Gewalt. Durch Einsamkeit. Durch Hunger. Durch Würdelosigkeit.
Sie haben sich nicht aufgegeben – sie sind aufgegeben worden.
Und was kaum jemand versteht:
So wird niemand über Nacht. So ein Mensch war mal anders. Hat mal gearbeitet. Gelacht. Geliebt. Aber er ist langsam gefallen. Immer ein Stück tiefer.
Und niemand hat ihn aufgehalten.
Und wenn er dann da sitzt, stumm, apathisch, im eigenen Schmutz –
dann gehen selbst die Hilfsbereiten weiter. Nicht, weil sie schlecht sind. Sondern weil diese letzte Form des Elends zu groß ist, um sie zu tragen.
Aber sie sind da.
Sie sterben leise.
Und niemand schreibt ihre Namen auf.
Die Todgeweihten grüßen euch
Damals hatte ich ein Buch gelesen, da ging es um römische Gladiatoren.
Sie traten vor ihren Kaiser, bevor sie in die Arena geschickt wurden, und sagten:
„Ave Caesar, morituri te salutant.“
„Heil dir, Cäsar – die Todgeweihten grüßen dich.“
Dieser Satz hat mich nicht mehr losgelassen.
Eines Morgens kamen wir unter der Brücke hervor, wo wir geschlafen hatten, und gingen zum Berliner Hauptbahnhof.
Ein ganz normaler Tag.
Der Platz war wie immer: laut, hektisch, voll von Menschen. Stimmen, Koffer, Hunde, Autos.
Ich stellte meinen Rucksack ab, reckte mich kurz, und sagte, fast beiläufig:
„Die Todgeweihten grüßen euch.“
Und plötzlich war es still.
Nicht symbolisch – wirklich still.
Für etwa 30 Sekunden sagte niemand etwas.
Nicht auf dem Platz, nicht im Vorbeigehen, nicht von den anderen draußen.
Als hätte dieser Satz etwas ausgesprochen, was ohnehin im Raum stand – aber nie jemand sagen durfte.
Dann kam wieder Bewegung. Gespräche. Geräusche. Alltag.
Aber diese halbe Minute bleibt mir bis heute.
Weil sie der einzige Moment war, in dem uns jemand wirklich gesehen hat.
Nicht als Penner. Nicht als Störung.
Sondern als Menschen,
die sterben könnten – und es wissen.
Rückblick
Ich bin heute nicht stolz auf diese Zeit.
Es war keine Heldengeschichte. Kein Kampf, den man gewinnt.
Es war Not, es war Erschöpfung, es war nacktes Überleben.
Und doch schäme ich mich nicht.
Denn ich habe gesehen, was Menschen aushalten können.
Ich habe Menschen erlebt, die alles verloren hatten – und trotzdem noch geteilt haben.
Und ich habe begriffen, dass Würde nichts mit Kleidung, Besitz oder einem festen Wohnsitz zu tun hat.
Ich weiß, dass viele, die heute noch draußen sind, bald nicht mehr da sein werden.
Ich habe diesen Blick gesehen. Ich erkenne ihn.
Und ich weiß, dass die Gesellschaft an ihnen vorbeigeht – nicht, weil sie hartherzig wäre, sondern weil sie überfordert ist.
Darum schreibe ich das hier.
Nicht, um Mitleid zu bekommen. Nicht, um Betroffenheit auszulösen.
Sondern in der Hoffnung, dass vielleicht einer hinhört, bevor es wieder zu spät ist.
Dass vielleicht einer stehen bleibt – bei jemandem, der sonst einfach verschwinden würde.
Und vielleicht einen Moment lang erkennt:
Der da – der ist einer von uns. Auch wenn er längst nicht mehr so aussieht.
Ich bin zurückgekehrt.
Aber ein Teil von mir ist dort geblieben.
Und ich glaube, dieser Teil wird auch nie wieder ganz zurückkommen.
Morituri te salutant – Die Todgeweihten grüßen Euch.
++++++++++++++++++++++++++
Text: André Hoek (https://www.andre-hoek.de/)
Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Andre_Hoek_neu.jpg
++++++++++++++++++++++++++
Wenn Du auch einen Beitrag in unserem Newsletter veröffentlichen möchtest, schreibe gerne an kontakt @ wohnungslosenstiftung dot org
Wenn Dir der Beitrag gefallen hat, kannst Du uns gerne durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Spendenkonto Rückhalt geben. Wir sind gemeinnützig und mildtätig und unterstützen direkt obdachlose und wohnungslose Menschen.
https://secure.spendenbank.de/form/3734
++++++++++++++++++++++++++++++++++
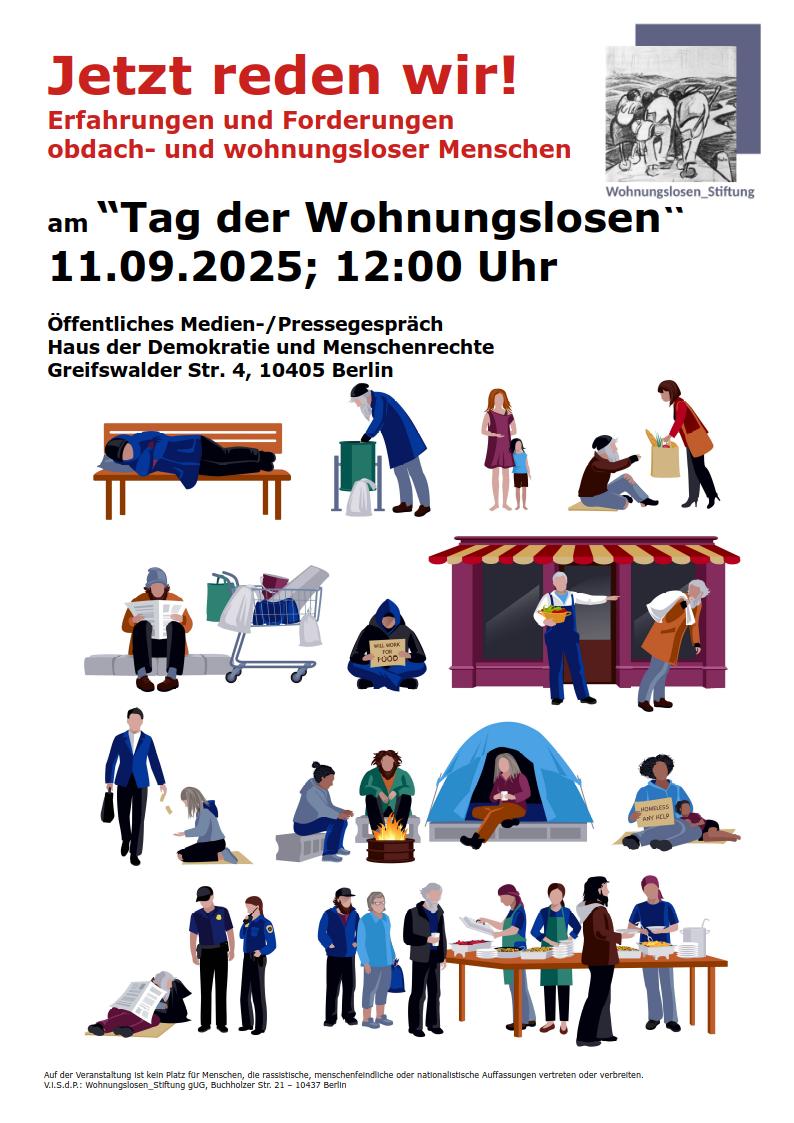
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Das ist eine Nachricht von
Stefan Schneider / Wohnungslosen_Stiftung
Gesellschaft für Selbstvertretung wohnungsloser Menschen
und Empowerment auf Augenhöhe gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Freistellungsbescheid vom 04.04.2023
für gemeinnützige und mildtätige Zwecke
Steuernummer: 27 / 613 / 06656
Handelsregister-Nummer: HRB 251093 B
Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Webseite: www.wohnungslosenstiftung.org
Newsletter: auf der Homepage oben links
Twitter: @wolo_stiftung
Facebook: www.facebook.com/Wohnungslosenstiftung/
Instagramm: www.instagram.com/wohnungslosen_stiftung/
Email-Verteiler: wohnungslosen_netzwerk@lists.riseup.net
Spendenkonto: Wohnungslosen_Stiftung
IBAN: DE60 3702 0500 0001 8534 01
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
PayPal: paypal.me/wolostiftung
Die Wohnungslosen_Stiftung ist die Interessenvertretung von Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung im deutschsprachigen Raum. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung sich austauschen, vernetzen und ihre Anliegen angstfrei äußern können.
In unserem offenen Netzwerk engagieren sich über 120 Menschen mit eigener Erfahrung, Gruppen, Initiativen, Bündnisse, Vereine und Unterstützer:innen – gemeinsam und auf Augenhöhe. Zweimal im Jahr organisieren wir offene Netzwerktreffen an wechselnden Orten, um den Austausch und die Zusammenarbeit zu stärken, politische Forderungen zu erarbeiten und gemeinsame Aktionen zu planen. Unser kostenloser Newsletter erreicht über 6.000 Interessierte und informiert unregelmäßig über Themen wie Wohnungslosigkeit, Empowerment und Selbstvertretung.
Wir sind gemeinnützig und mildtätig. Mit Deiner Spende – ob einmalig oder monatlich – hilfst Du uns, unsere Arbeit stabil und unabhängig fortzuführen. Gemeinsam können wir etwas bewegen!